Ob man, mit Hinblick auf die künftige John Sinclair Aufgabe, noch Zeit für Hui Buh im Hause STIL haben wird?
Beiträge von DerPoldi
-
-
Sorry, falsches Thema.
-
Gut, sonst hätte ich es für dich Bestellt und mit der Hörspielkiste mitgeschickt.
-
Bei Amazon für aktuelle 6,98€ ohne Lieferkosten
 Gruselkabinett - Folge 100: Träume im HexenhausArkham, 1927: Der Student Walter Gilman bezieht ein Zimmer in einem sagenumwobenen Haus. Im Hexenwahn des späten 17. Jahrhunderts soll dort angeblich eine der…www.amazon.de
Gruselkabinett - Folge 100: Träume im HexenhausArkham, 1927: Der Student Walter Gilman bezieht ein Zimmer in einem sagenumwobenen Haus. Im Hexenwahn des späten 17. Jahrhunderts soll dort angeblich eine der…www.amazon.de -
Sherlock Holmes Chronicles - 71. Die Spur des Falken
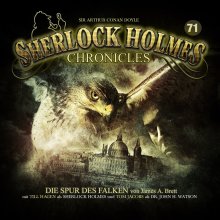
Eine Serie an Diebstählen von wertvollen Kunstgegenständen beschäftigt nicht nur die Londoner Devision von Scotland Yard, sondern auch die Presse der Hauptstadt. Denn wie um die Polizei zu verhöhnen, hinterlässt der Dieb als Signatur immer einen Hinweis auf seinen Namen: Der Falke. Als Dr. Watson seinen Freund Sherlock Holmes auf den Fall anspricht, beginnt auch dieser mit seinen Ermittlungen...
Viele der neu geschriebenen Geschichten für die Sherlock Holmes Chronicles haben einen etwas reißerischen Charakter als die Originalgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle. Folge 71 mit dem Titel „Die Spur des Falken“ präsentiert zwar auch ein Verbrechen, das in London für viel Aufsehen sorgt, ist in der Ermittlungsarbeit aber klassisch angelegt und verbreitet eine Stimmung, die dichter an den Originalen gehalten ist - auch wenn die Introszene nicht mit einem neuen Mandanten startet, sondern ein Zwiegespräch von Holmes und Watson über den Fall des Falken beinhaltet - wie auch in der restlichen Geschichte wird auch hier schon der feine Humor der Figuren eingebunden. Danach zeigt sich, dass der Titel der Geschichte äußerst passend gewählt wurde, da Holmes verschiedene Spuren verfolgt und dabei immer weitere Details erfährt. Die Ausgangspunkte sind dabei erst einmal unscheinbar, ein bestimmter Farbton spielt eine ebenso große Rolle wie der Hersteller eines Tresors. Dabei werden ganz unterschiedliche Figuren eingebunden, wobei jeder seine ganz eigene Aura mit einbringt und viele potenzielle Verdächtige in den Kreis der Ermittlungen rücken. Auch die feinsinnige Ermittlungsweise von Holmes mit einigen Finten und Tricks tragen zum Reiz der Folge bei, wobei das Verständnis durch einige ruhige Gespräche zwischen Holmes und Watson erleichtert wird - und Holmes immer nur einen Teil der Lösung präsentiert. Das ist geschickt aufbereitet und führt zu einem sehr stimmigen Ende, was die ruhige Folge gelungen abschließt.
Mr. Falconer, ein diensthabender Wachmann, wird von Patrick Winczewski gesprochen, der sich gekonnt an die Stimmung der Serie anpasst und die geschliffenen Dialoge gekonnt präsentiert und einige gekonnte Feinheiten einbaut. Inspector Gregson bekommt seine Stimme von Torsten Münchow geliehen, der zu dem feinsinnigen Holmes einen deutlich lauteren, tumperen Eindruck hinterlässt und so die Rolle sehr lebendig zu sprechen versteht. Lord Ashley wird von Tino Kießling gesprochen, der seiner Figur eine wunderbar affektierte Note verleiht und dabei sehr nuanciert spricht, was den Adeligen eine markante Aura verleiht. Weitere Sprecher sind Hans-Jürgen Dittberger, Uschi Hugo und Helmut Krauss.
Ein paar der Melodien, die in der akustischen Gestaltung eingesetzt wurden, sind bereits aus vorigen Episoden bekannt. Da diese leise im Hintergrund eingesetzt sind, sorgt das für einen Wiedererkennungswert, ohne dass es störend wirken würde. Einige neue Musikstücke und eine passende Geräuschkulisse sorgen wie immer bei der Serie für einen sehr stimmigen Eindruck.
Das Cover der Folge ist wieder außerordentlich gut gelungen, die erdige Farbgebung der Serie passt wunderbar zu der Collage aus dem Gebäude, dem halb im Dunkeln liegenden menschlichen Gesicht und im Zentrum der detaillierten Illustration des Falken. Und wie immer gibt es auch in diesem Cover die Informationen zu den beiden Hauptsprechern und ein Grußwort von Markus Winter.
Fazit: Ein Krimi klassischer Machart, in der Sherlock Holmes durch hartnäckige Ermittlungen, einige geschickte Finten und seinen typischen Scharfsinn eine Diebstahlserie aufklärt. Mir gefällt, wie die Bekanntheit von Holmes immer wieder thematisiert wird und die Folge beeinflusst. Die vielseitigen Charaktere und der gradlinige Aufbau sorgen für einen gelungenen Gesamteindruck.
VÖ: 10. Januar 2020
Label: WinterZeit
Bestellnummer: 9783960662310 -
Sherlock Holmes Chronicles - 72. Betrifft: Vampire
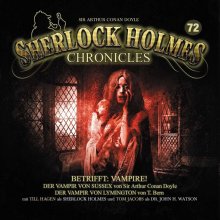
Sherlock Holmes erfährt durch einen Brief von Robert Ferguson, der seine Gattin dabei ertappt hat, ihrem neugeborenen Baby das Blut ausgesaugt zu haben. Sherlock Holmes glaubt natürlich nicht an Vampirismus und untersucht den Fall... (Der Vampir von Sussex)
Jeremy Smith sucht die Hilfe vom Sherlock Holmes, da ein Vampir in seinem Heimatort sein Unwesen treiben soll. Doch nicht nur er allein, sondern auch andere Dorfbewohner wollen den Wiedergänger bei seinen Taten beobachemtet haben... (Der Vampir von Lymington)
Der ungewöhnliche Folgentitel "Betrifft: Vampire" für die 72. Episode der "Sherlock Holmes Chronicles" ist eine kleine Variation eines Zitates aus "Der Vampir von Sussex" aus der Feder von Sir Arthur Conan Doyle - ein Teil dieser Folge, die aus zwei Geschichten besteht. Die andere lautet "Der Vampir von Lymington" und ist neueren Datums, T. Bern hat diese für eine Anthologie mit neuen Fällen für die bekannte Figur geschrieben. Klassiker und Neuinterpretation sind hier also vereint auf einer CD, und beide Episoden sind wieder gut gelungen.
"Der Vampir von Sussex" zeichnet sich durch einen recht klassischen Aufbau aus, nach dem Bericht seines Klienten reist er vor Ort, hat den Fall aber eigentlich bereits gelöst und wartet auf den richtigen Zeitpunkt für seine Erläuterungen. Die Geschichte lässt sich Zeit, die Gespräche sind recht ruhig aufgebaut, sodass man sich langsam ein Bild von den Lebensumständen der Figuren sind natürlich von der unglaublich erscheinenden Tat selbst machen kann. Die Auflösung des Ganzen wird zwar zuvor durch Holmes Reaktionen bereits angedeutet, bietet aber dennoch gekonnt kleine Überraschungen. Die Umsetzung sehr nahe am Original ist gelungen, zumal die Stimmung der Folge sehr gut zur Geltung kommt.
"Der Vampir von Lymington" verzichtet auf Dr. Watson als Erzähler, sondern lässt einen externen Erzähler durch die Handlung führen. Interessant, wie sehr dieser kleine Kniff die Stimmung der Geschichte beeinflusst. Diese setzt dann auch noch deutlicher auf einen Gruseleffekt, ist brutaler und blutiger in der Erzählweise. Es spielt aber auch mehr ein Hauch des Übernatürlichen über diese Episode, mehr noch als im Original von Doyle. Die Spannung, die sich dadurch aufbaut, ist gekonnt umgesetzt und bringt noch einmal ganz andere Facetten mit ein. Eine überraschende Episode, die vielleicht etwas sperrig wirkt, aber dennoch hörenswert ist und ein ungewöhnliches Finale präsentiert.
In der ersten Episode wird Robert Ferguson von Olaf Reichmann gesprochen, der eine sehr gradlinige und solide Sprechweise darbietet, sich aber angenehm zurücknimmt und den markanteren Figuren der Episode die Bühne überlässt. Beispielsweise Elke Appelt als seine Gattin, die die aufwallenden Gefühle wie Wut und Angst, aber auch Resignation sehr lebendig spricht und so eine vielschichtige Figur schafft. Sie wirkt in ihren Szenen sehr präsent und prägt dabei die Wirkung der Episode. In der zweiten Geschichte überzeugt Leonard Mahlich in der Rolle des Jeremy Smith, indem er sehr lebendig spricht und viel Energie mit einbringt, er spricht ausdrucksstark und markant. Weitere Sprecher sind Frank Felicetti, Margot Rothweiler und Christian Zeiger.
Auch die akustische Gestaltung der Episode überzeugt und bringt auch etwas Abwechslung in die Serie, beispielsweise wenn zu Beginn ein Spinnett erklingt. Doch auch die ruhige Musikuntermalung der Dialoge oder Erzähltexte sowie die stimmige Geräuschkulisse sind sehr passend umgesetzt und unterstützen das Thema der beiden Episoden mit einem leichten Gruselfaktor.
Das Titelbild der Episode ist von Marc Freier wieder sehr ansehnlich umgesetzt worden. Die Frau mit dem halb erschrockenen, halb verführerischen Gesichtsausdruck und mit der roten Farbgebung passt zudem wunderbar zu der ersten Episode dieser Folge. Im Inneren gibt es natürlich wieder einen lesenswerten Einleitungstext von Markus Winter sowie erfreulicherweise nun auch einen Folgenindex mit allen bisher erschienenen Titeln der Reihe.
Fazit: Zwei Episoden, die sich zunächst auf gleiche Weise dem Thema Vampirismus wirken, die aber dennoch ganz andere Ansätze finden und auf unterschiedliche Weise enden. Und so hat man einen klassischen Fall von Doyle ebenso wie eine neue Geschichte, die etwas sperrig wirkt, aber auch gekonnt neue Akzente setzt. Schön, wie das Krimigenre hier immer wieder neu abgesteckt wird.
VÖ: 7. Februar 2020
Label: WinterZeit
Bestellnummer: 9783960662327 -
Das Schwarze Auge – 6. Kampf um die Macht

Nach einer gefährlichen Reise mit vielen Entbehrungen und Verlusten ist die Gruppe um Gundar Gemmenschneider ihrem Ziel so nah wie sie, endlich können sie Lares vom Weißen Turm das Schwert und den Ring seiner Familie überreichen. Doch eine letzte Hürde stellt sich ihnen in den Weg, denn Dexter von Crumold will die Übergabe unbedingt verhindern...
Von Anfang an war der erste Handlungsstrang von „Das Schwarze Auge“, der Coproduktion von WinterZeit und Audionarchie, auf sechs Folgen ausgelegt, sodass man in „Kampf um die Macht“ bereits ein erstes großes Finale erleben kann – und zwar wie es sich für eine Fantasy-Serie gehört ein episches. Zunächst startet die Episode aber erst einmal wie gewohnt mit seiner abenteuerlichen Szenerie, in die sich aber auch ein Hauch Melancholie einschleicht. Wieder muss die Gruppe sich bewähren, lernt einzelne Mitglieder von einer anderen Seite kennen und wächst dadurch weiter zusammen. Auch das ist wieder gut erzählt, die ganz große Überraschung kommt aber wirklich erst gegen Ende der Episode, in dem sich alles noch einmal von einer ganz anderen Seite präsentiert. Diese eingebaute Idee ist so einschneidend, dass sie auch die bisherigen Ereignisse in ein ganz anderes Licht rückt und man gedanklich zurückgeht, die Handlungen noch einmal Revue passieren lässt und versucht ist, einfach noch einmal reinzuhören – und genau das ist es eigentlich, was ich (unter anderem) von einem stimmigen Fantasy-Werk erwarte. Dass die Spannung dabei deutlich steigt, die Stimmung sehr dicht ist und alles gekonnt konzipiert ist, ist dabei fast schon klar, hier merkt man wieder der Feinschliff, den die Serie erfährt. Ein gelungener Abschluss des ersten Handlungsstrang, der gleichwohl schon einige Fäden für die Zukunft anlegt.
Marcus Off hat sich bereits in den vorigen Episoden als Filoen bewiesen und setzt diesen positiven Eindruck auch hier wieder fort, indem er zwar die typischen Eigenschaft von Elfen einbaut und dennoch seinen ganz eigenen Weg findet. Julius Jellinek ist als Lares vom Weißen Turm ebenfalls wieder sehr überzeugend, er spielt hier etwas mehr mit seiner Stimme und kann so seine Szenen sehr intensiv ausgestalten. Als Dexter ist Peter Flechtner zu hören, durch ihn wird die düstere Szenerie noch verschärft, er schafft einen weiteren prägnanten Charakter in der phantastischen Welt. Weitere Sprecher sind Axel Ludwig, Claus-Peter Damitz und Gabrielle Pietermann.
Die akustische Umsetzung der Episode ist erneut bestechend geraten und nicht nur sehr gut auf die Handlung abgestimmt, sondern setzt auch das Fantasy-Genre gut um und lässt den Hörer in die fremde Welt eintauchen. Musik und Geräusche funktionieren dabei besonders gut zusammen, was besonders die dramatischen Szenen am Ende beweisen.
Ein dunkler Nachthimmel, für ein bisschen mehr Pathos von Blitzen erleuchtet, darunter einer riesige Burg, auf deren Zinnen zwei Männer in voller Rüstung im Flammenschein kämpfen – auf dem Cover wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Optisch sehr gut in Szene gesetzt, im Inneren sind jedoch neben dem bereits bekannten Text über Aventurien keine weiteren Informationen entalten.
Fazit: Nach dem fast schon klassischen Start mit neuen Gefahren und neuen Erkenntnissen über die Gefährten gibt es noch das große Finale des ersten Handlungsstrang mit krassen Wendungen und einer ganz neuen Perspektive auf die bisherige Staffel. Ein sehr gute Abschluss, der sowohl den Wunsch weckt, die bisherigen Folgen noch einmal zu hören, als auch Lust auf die neuen Intrigen, Kämpfe und Reisen in Aventurien macht.
VÖ: 27. Juli 2018
Label: WinterZeit / Audionarchie
Bestellnummer: 978-3-96066-004-0 -
Das Schwarze Auge – 5. Im Reich des Nekromanten

Gundar Gemmenschneider und der Rest der unfreiwilligen Reisetruppe sind fast an ihrem Ziel angekommen, dem weißen Turm, in dem Siegelring und Schwert der Familie verschollen sind. Doch eine riesige Armee Untoter wartet vor den Toren und versperrt ihnen den Weg – bis Gundar eine ebenso selbstmörderische wie geniale Idee hat. Währenddessen muss sich Lares vom Weißen Turm in seiner Heimatstadt erneut bösartigen Intrigen aussetzen...
In der fünften Folge der Reihe macht „Das Schwarze Auge“, eine Koproduktion von WinterZeit und Audionarchie, einen deutlichen Sprung nach vorne und treibt die Rahmenhandlung wieder verstärkt voran. Denn das Ziel der Reise wird hier tatsächlich erreicht, doch davor stehen natürlich wieder zahlreiche Gefahren, die bezwungen werden müssen. Wie der Titel schon erahnen lässt, hat die Folge einen düsteren, makabren Einschlag, welcher einen speziellen Reiz verleiht und für einige unheimliche Momente sorgt. Dass sich dabei alles weiter aufbaut, versteht sich fast von selbst, wobei die Begegnung mit dem Herren des Weißen Turms der unumstrittene Höhepunkt ist – und sehr gut ausgekostet wird. Darin eingebunden ist eine sehr gut erzählte Szene, in der ein sehr anderes Licht auf einen der Charaktere geworfen wird. Der Handlungsstrang um Gundar Gemmenschneider erweist sich als sehr unterhaltsam und mit einigen trickreichen Wendungen versehen und gleicht damit den nicht ganz so starken Teil um Lares etwas aus. Zwar ist die gesponnene Intrige um seinen Mentor Sardos auch mit einigen starken Szenen versehen, die ganz großen Emotionen werden dabei aber einfach nicht geweckt. Insgesamt fügt sich aber wieder alles stimmig zusammen, es gibt viele Überraschungen und noch tiefere Einblicke in einige Charaktere und die Gruppendynamik. Dass die Stimmung dabei so dicht ist, dass es kaum auffällt, dass sich die Handlung recht langsam entwickelt.
Angela Wiederhut steht hier als Leonida von Beilunk noch mehr im Mittelpunkt als sonst und verleiht ihrer Figur dabei mehr Tiefe, wobei sie in einigen emotionalen Szenen besonders die Selbstzweifel der engagierten Frau gekonnt zum Ausdruck bringt. Eckart Dux verlieht mit seiner tiefen Stimme der Rolle des Sardos eine sehr eindringliche Aura und kann seine Szenen sehr gut zur Geltung bringen und den Charakter so noch weiter stärken. Richtig gut gefallen hat mir auch Otto Schenk, der Jangorn vom Weißen Turm spricht und diesen mit so scharfer und schneidender Stimme spricht, dass die Szenen auch so eine intensive Ausstrahlung bekommen. Weitere Sprecher sind Gabrielle Pietermann, Marco Kröger und Björn Schalla.
Die opulente akustische Gestaltung ist seit dem ersten Teil der Reihe ein fester Bestandteil der Umsetzung und kommt auch hier wieder sehr gut zur Geltung. Besondere Erwähnung verdienen dabei die Szenen um den Herrscher des Weißen Turms, die nicht nur mit vielen Geräuschen und intensiver Musik hervorstechen, sondern auch mit sehr gelungenen Stimmverzerrefekten.
Auch die Covergestaltung ist wieder sehr ansehnlich geraten, eine schwarze Burg ragt darauf aus einem stürmischen Meer hervor, nur spärlich von einer rot untergehenden Sonne beleuchtet ist. Schade nur, dass ausgerechnet diese vom Schriftzug verdeckt wurde, im Inneren des Booklets ist aber unter anderem die komplette, detailreiche Zeichnung zu sehen.
Fazit: Am Ziel angekommen verliert die Geschichte um die Reisegruppe keineswegs an Spannung, sondern legt in dieser Folge erst richtig los. Die düstere Atmosphäre steht dabei im Vordergrund und legt den Fokus wieder auf einzelne Elemente, die so sehr gut zur Geltung kommen. An der einen oder anderen Stelle hätte die Entwicklung aber ruhig noch schneller sein können.
VÖ: 6. April 2018
Label: WinterZeit / Audionarchie
Bestellnummer: 978-3-96066-02-6 -
Sherlock Holmes – 25. Der Angestellte des Börsenmaklers
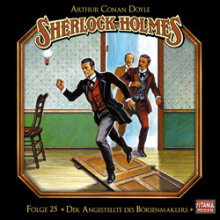
Hall Pycroft hat gerade eine neue Anstellung als Börsenmakler bekommen, als ihm ein anderes, lukratives Angebot gemacht wird: Ein Unternehmen bietet ihm für die neu aufzubauende Niederlassung nicht nur eine hochdotierte Position, sondern auch gleich den Posten des stellvertretenden Geschäftsführers. Doch mit der Zeit kommen dem jungen Mann Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Arbeitgeber, sodass er sich an Sherlock Holmes wendet...
Mit „Der Angestellte des Börsenmaklers“ hat Titania Medien eine recht bekannte Geschichte um Sherlock Holmes als 25. Folge der gleichnamigen Serie vertont, die einige sehr klassische Grundzüge hat und den Scharfsinn des Meisterdetektivs sehr gut umreißt. Dabei findet das Geschehen ziemlich lang in den Gemächern von Holmes statt, wobei hier eine sehr sinnige Lösung für eine Auflockerung gefunden wurde: Statt eines einfachen Monologs ist der Bericht des neuen Mandanten so oft es geht als Dialog umgeformt worden, sodass ein durchaus lebendiger Eindruck entsteht. Zwar dauert es ein wenig, bis die Folge in Gang kommt, vor allem weil der anfängliche Dialog von Holmes und Watson eher gediegen denn spitzzüngig ist. Der Bericht von Pycroft fängt aber schon durchaus interessant an, dem Hörer wird dabei eine gelungene Denkaufgabe präsentiert – er kann durchaus Miträtseln und sich seinen eigenen Reim auf die Ereignisse machen. Der Verlauf ist dabei recht gleichförmig, da wenige Highlights oder dramatische Szenen in der Erzählung von Arthur Conan Doyle vorkommen, dennoch ist der Verlauf durchaus kurzweilig. Das Ende ist ungewöhnlich und konnte dabei bei mir voll punkten. Und da auch die Inszenierung des Klassikers gelungen ist, zeigt der Daumen bei der Bewertung nach oben!
Gerade einmal fünf Sprecher sind für die Vertonung der Geschichte notwendig, sodass bei jedem einzelnen natürlich viel Wert auf eine lebendige Darstellungsweise gelegt wird. Das wunderbare Duo aus Joachim Tennstedt und Detlef Bierstedt macht seine Sache wie immer äußert vergnüglich und eingängig, besonders im Zusammenspiel entfalten sie ihre komplette Stärke. Florian Jahr ist als Hall Pycroft zu hören, er setzt dabei gekonnte Akzente und kann mit einer glaubwürdigen Performance punkten. Matthias Lühn spricht Arthur Pinner mit einer sehr akzentuierten und betonten Stimme, die gut zu der Rolle passt. Auch die kurze Nebenrolle von Marc Gruppe konnte überzeugen.
Auch wenn sich das Produzententeam bei dieser Reihe etwas zurückhält, ist ein gewisser Hang zur Dramatik nicht abzusprechen. So ist die Musik, auch wenn sie nicht allzu häufig eingesetzt wurde, sehr stimmungsvoll und unterstützt die Szenen in ihrer Wirkung. Und auch die eingesetzten Geräusche treffen jeweils genau den richtigen Ton und bringen mehr Lebendigkeit mit ein.
Eine eingetretene Tür, Sherlock Holmes in dynamischer Läuferpose, Waston dicht hinter ihm, Hall Pycroft mit verdutztem Gesicht im Türrahmen – das Cover deutet mehr Action an, als dann in der Folge wirklich vorhanden ist. Dennoch sind die gedeckten Farben und der nostalgische Zeichenstil sehr passend gewählt und stimmen den Hörer gekonnt auf die Atmosphäre der Serie ein.
Fazit: „Der Angestellte des Börsenmaklers“ ist zwar nicht die aufregendste Geschichte aus dem Portfolio des Meisterdetektivs, punktet aber mit einer rätselhaften Handlung und markanten Szenen. Besonders das ungewöhnliche Ende konnte mich dabei überzeugen, und auch die Umsetzung von Titania Medien muss wieder lobens hervorgehoben werden.
VÖ: 12.August 2016
Label: Titania Medien
Bestellnummer: 978-3-7857-5258-6 -
Sherlock Holmes – 26. Die Gloria Scott
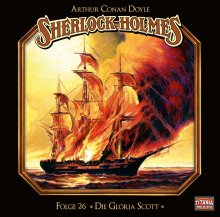
Obwohl Sherlock Holmes und Dr. Watson bereits seit langer Zeit befreundet sind, hat der Mediziner und Chronist noch nicht vom ersten Fall des noch jungen Detektivs erfahren, was nun bei einer Kanne Tee von Mrs. Hudson nachgeholt werden soll. Und so berichtet Holmes von seinem Studienfreund Victor Trevor, dessen Vater und einem unwillkommenem Gast, der sich bei den Trevors im Haus einnistet...
Sherlock Holmes kennt man als abgeklärten Detektiv, den so leicht nichts mehr erschüttern kann, der sich in unzähligen Fällen bewähren konnte. Doch selbst Arthur Conan Doyle hat es gereizt, auch seine Jugend zu erkunden, sodass er mit „Die Gloria Scott“ eine Episode aus seinem Leben erzählt, in der er zum ersten mal seine Deduktionskünste nutzt. Titania Medien hat diese Geschichte nun als 26. Folge seiner erfolgreichen Serie um den Meisterdetektiv als Hörspiel umgesetzt. Der Einstieg ist etwas lang geraten – schließlich gilt es, neben der einleitenden Szene mit Watson und Mrs. Hudson auch noch die damaligen Lebensumstände von Holmes aufzudecken. Trotz dieser Länge sind die ersten Szenen sehr unterhaltsam gelungen, da man in der Tat einige gelungene Details entdeckt und eine angenehme Grundstimmung vorherrscht. Auch das Kennenlernen von Victor und den anderen Nebencharakteren der Folge geht recht gediegen von statten, Marc Gruppe und Stephan Bosenius lassen sich viel Zeit, um alles gründlich vorzustellen und legen auf eine umfangreiche Darstellungsweise wert. Für den Hörer gibt es derweil einiges zu errätseln, denn vieles liegt im Dunkeln und ist gar nicht so einfach in Zusammenhang zu setzen. Nur langsam lichtet sich das große Geheimnis und wird – ganz untypisch für die Erzählungen von Doyle – erst aufgeklärt, als es eigentlich schon zu spät ist. Keine spektakuläre Auflösung, bei dem Holmes in einem Geniestreich die Verdächtigen überführt, sondern eine fast schon stille Antwort auf die aufgeworfenen Fragen. Das führt die Handlung in eine ganz andere Richtung als bisher gedacht und hat mich sehr überzeugt, da mal andere Facetten als bisher im Vordergrund stehen und dennoch ein trickreicher Kriminalfall erzählt wird.
Julian Tennstedt hat nicht nur einen wohl bekannten Vater, der gerade den Hörern dieser Reihe etwas sagen dürfte, sondern spricht auch den jungen Sherlock Holmes in dieser Folge. Das macht er auf eine sehr charmante Weise und lässt die Grundzüge des schillernden Charakters durchklingen, findet aber seine ganz eigene und überzeugende Weise der Interpretation. Dirk Petrick ist als Victor Trevor zu hören, der sehr freundlich und agil klingt, er spricht sehr glaubhaft und mit eingängigem Rhythmus. Berd Rumpf hat mir als Hudson äußerst gut gefallen, seine laute und polternde Stimme sowie seine fordernde und unverschämte Art formen einen sehr ausdrucksstarken Charakter. Weitere Sprecher sind Jochen Schröder, Maximiliane Häcke und Jannik Endemann.
Auch wenn die Sprecher und ihre Dialoge hier stets im Mittelpunkt stehen und sich wegen der ruhigen Erzählweise sowieso keine hochtrabende akustische Umsetzung anbietet, wurde wieder ein feines Netz gewoben, das die Szenen in ihrer Wirkung sehr gut unterstützt und durch einige wohl platzierte Geräusche für eine lebendige Stimmung sorgt.
Wie ein altes Ölgemälde wirkt das Cover in seinem goldenen Rahmen und dem schwarzen Hintergrund, auch sind dieses mal keine menschlichen Gesichter zu sehen. Ein lodernd brennendes Segelschiff hat Ertugrul Edirne hier gezeichnet und es mit den dicken Rauchschwaden und den hellen Flammen sehr gekonnt in Szene gesetzt.
Fazit: Die Reise in die Jugend von Sherlock Holmes erreicht zwar nicht ganz den Witz, der sonst von Dr. Watson so liebevoll eingebracht wird, ist aber eine ungewöhnlich erzählte und sehr ruhige Folge, die mit ihrem langsamen Aufbau und den sich steigernden Spannungsbögen gut unterhalten kann und zudem einen interessanten Blick auf den jungen Holmes erlaubt.
VÖ: 14.Oktober 2016
Label: Titania Medien
Bestellnummer: 978-3-7857-5380-4 -
Gruselkabinett – 100. Träume im Hexenhaus
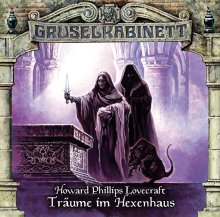
Walter Gilman, ein Student der Mathematik und Physik, stößt in alten Aufzeichnungen auf die Geschichte der Hexe Keziah Mason, die angeblich in die vierte Dimension eindringen konnte. Er steigert sich immer weiter in seine Recherchen herein und findet schließlich heraus, wo die alte Vettel bis zu ihrem qualvollen Tod während der Inquisition gewohnt hat – und mietet sich kurzerhand in das kleine Dachzimmer des alten Hauses ein...
Die magische 100. Folge hat Titania Medien nun mit dem Gruselkabinett erreicht, mittlerweile gehört die Serie zu den erfolgreichsten und am meisten beachteten der Hörspiellandschaft. Die Spannung war natürlich groß, welche Adaption sich Stephan Bosenius und Marc Gruppe für dieses Jubiläum aussuchen würden, die Wahl ist auf eine Geschichte aus dem Arkham-Zyklus von H. P. Lovecraft gefallen: „Träume im Hexenhaus“. Zwar kann es hilfreich sein, wenn man sich etwas in der Welt des bekannten Horror-Autoren auskennt, um alle Querverweise zu verstehen, notwendig ist dies aber nicht, die Geschichte kann auch vollkommen für sich allein stehen. In den ersten Szenen wird von Keziah Masons Tod berichtet, was schon sehr stimmungsvoll und eindringlich geraten ist. Mit der Schwenk auf Walter Gilman viele Jahre später baut sich die Handlung langsam auf, setzt aber immer wieder mit sehr unheimlichen und gruseligen Szenen Akzente. Die Stimmung ist durchgehend sehr dicht, kann sich aber natürlich im Laufe der Handlung noch weiter steigern, entführt den Hörer zusammen mit Walter in eine Parallelwelt, bald kann man kaum Traum und Realität auseinander halten. Die packende und dramatische Schlussszene setzt dann einen schrecklichen Höhepunkt. „Träume im Hexenhaus“ mag das Genre nicht neu erfinden, ist aber eine extrem gelungene Folge, die mit ihrer sehr intensiven und beeindruckenden Stimmung überzeugen kann.
Hannes Maurer ist in der Hauptrolle des Walter Gilman zu hören und übernimmt damit einen großen Teil der Handlung, er kann den aufkommenden Horror sehr eingängig darstellen, auch wenn er an einigen Stellen die Spannung nicht ganz aufrecht erhalten kann. Grandios ist Dagmar von Kurmin als Keziah Mason, ihre tiefe und kehlige Stimme passt wunderbar zu der Rolle, die sie mit viel Leidenschaft und packender Präsenz umsetzt. Roland Hemmo ist als schwarzer Mann ebenso gut besetzt und lässt seine Szenen ebenfalls sehr unheimlich und düster wirken. Weitere Sprecher sind Wilfried Herbst, Hans-Geord Panczak und Horst Naumann.
In Sachen Atmosphäre und Dramatik darf man vom Gruselkabinett natürlich auch in der 100. Folge eine absolut perfekte Inszenierung erwarten, wobei mit die eingesetzte Musik dieses mal besonders gut gefallen hat. Die wirkt noch einen Tick düsterer und kann dabei die Stimmung der Handlung bestens einfangen. Und auch die Geräusche und Effekte tragen ihren Teil zum Gelingen der Produktion bei.
Eine sehr unheimliche Szenerie wurde hier für das Cover umgesetzt, die Keziah Mason, einen dunklen Mann und eine riesige Ratte vor einem steinernen, reich verzierten Altar zeigt, der Raum ist im Hintergrund mit riesigen Säulen angedeutet. Die violette Farbgebung ist der Geschichte geschuldet, passt aber auch wunderbar zu dem Artwork der Folge. Als Zugabe zur Jubiläumsfolge gibt es eine DVD mit einer über 50-minütigen Dokumentation, in der Interviews, Studioaufnahmen aber auch Szenen der Arbeit der Macher zu sehen sind. Das ist ein kurzweiliger und unterhaltsamer Einblick hinter die Kulissen.
Fazit: Die Jubiläumsfolge vom Gruselkabinett ist sehr atmosphärisch dicht und eindringlich gelungen, wobei die Szenen mit Keziah Mason besonders unheimlich gelungen sind. Die sich immer weiter aufbauende Dramatik ist beeindruckend und lässt die über einstündige Produktion sehr flüssig erscheinen. Besonders das intensiv umgesetzte Finale kann dabei punkten.
VÖ: 15.Mai 2015
Label: Titania Medien
Bestellnummer: 978-3-7857-5117-6 -
Gruselkabinett – 101. Verlorene Herzen
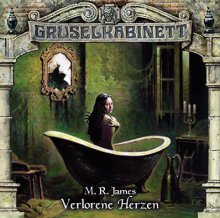
Nach dem Tod seiner Eltern kommt der kleine Stephen zu einem entfernten Verwandten unter, dem alleinstehenden, aber wohlhabenden Mr. Abney. Viel Kontakt hat er zwar zu seinem neuen Vormund nicht, dafür kümmert sich die Haushälterin Mrs. Bunch umso fürsorglicher um den Jungen. Sie erzählt ihm, dass vor einiger Zeit bereits ein anderer Junge von Mr. Abney aufgenommen wurde...
Von Fans mit Spannung erwartet wurde die 100. Folge des Gruselkabinetts von Titania, doch auch danach geht es natürlich wie üblich mit atmosphärischen Gruselgeschichten weiter. Folge 101 ist „Verlorene Herzen“ des britischen Autors M. R. James, der bereits einige Male Vorlagen für die Reihe geliefert hat. Die Geschichte ist recht vorhersehbar, schon nach wenigen Minuten ist dem Hörer klar, worum es hier geht und wie die Geschichte weiter verlaufen wird – vielleicht mit Ausnahme des endgültigen Showdowns. Dennoch schätze ich diese Folge sehr, denn die Atmosphäre ist hier unglaublich dicht und intensiv, sodass einem wirklich einige Gänsehautschauer über den Rücken laufen. Stephen bekommt es mit einigen Geistererscheinungen zu tun, die sehr inbrünstig inszeniert wurden und das typische Feeling der Serie aufkommen lassen. Zudem steigert sich dies immer mehr und findet schließlich in einem sehr eindrucksvoll erzählten Finale seinen Höhepunkt - nur um kurz darauf mit den Aufzeichnungen von Mr. Abney noch einen sehr gekonnten Abschluss zu finden, der dieses Gefühl noch einmal steigert. „Verlorene Herzen“ mag diejenigen enttäuschen, die miträtseln und sich überraschen lassen wollen, für Fans des gepflegten Gruselhörspiels ist es aber eine weitere Perle.
Alexander Mager ist in der Hauptrolle des Stephen Elliot zu hören. Er ist noch ein sehr junger und unerfahrener Sprecher und wird sicherlich noch lernen, lebendiger und spontaner zu klingen, zeigt aber einige gute Ansätze für glaubhaften Gefühlsausdruck. Der grandiose Uli Krohm setzt die Figur des Mr. Abney sehr gekonnt und eindringlich in Szene, sodass von dem düsteren Mann eine sehr geungene Aura ausgeht. Auch Dorothea Walda hat mir als Mrs. Bunch äußerst gut gefallen, ihre warmherzige und gutmütige Art kommt hier bestens zur Geltung. Weitere Sprecher sind Kaspar Eichel, Timmo Niesner und Liv Auhage.
Vom Gruselkabinett darf man glücklicherweise immer eine sehr runde und gelungene Produktion erwarten, und dabei wird man auch hier nicht enttäuscht werden. Die Musik wirkt wie eigens auf die Handlung zugeschnitten und verleiht ihr viel von der fast schon beschwörenden Stimmung, während die Geräusche gerade in den unheimlichen Szenen für den notwendigen Schwung sorgen. Sehr gelungen!
Meiner Ansicht nach wurde für diese Folge eines der besten Cover der ganzen Serie geschaffen, und das will bei den grandiosen Vorgängern schon etwas heißen! Ein einsames Mädchen sitzt nackt in der Badewanne eines ziemlich heruntergekommenen Badezimmers, die Fingernägel zu langen Klauen verformt, der Blick geht leidend über die Schulter zum Betrachter. Die düstere Stimmung, die hier vorherrscht, passt bestens zum Hörspiel selbst.
Fazit: Auch wenn diese Folge nur wenige Überraschungen bietet, die sehr dichte und intensive Stimmung sorgt für viel Gänsehautgefühl und einen flüssigen Verlauf. Die sehr gruseligen Szenen sind großartig umgesetzt worden, besonders das Ende ist prägnant erzählt worden. Wieder eine sehr gelungene und bestens inszenierte Folge des Gruselkabinetts.
VÖ: 15. Mai 2015
Label: Titania Medien
Bestellnummer: 978-3-7857-5188-3 -
Wer sich von den heutigen Studios eignen würde ... gute Frage, ich bin in der Thematik nicht mehr wirklich drin.
Ich denke hier wäre STIL auch eine gute Adresse gewesen.
-
Allein bei dem Gedanken das TSB Harry Potter als Hörspiel umgesetzt hätte Grusel es mich.....
-
Wenn etwas auf Blu-Ray erscheint das ich bisher nur als DVD habe dann tausche ich häufig sogar aus.
Vor einigen Jahren ist Akte X auf Blu-Ray erschienen, die hatte ich bis dahin auf DVD und habe mir dann am Tag des Erscheinens die Blu-Ray Box für günstige 80€ gekauft.
Von Disney sind zwei der alten Zeichentrickfilme im letzten Jahr als 4K Version erschienen, die habe ich mir auch zugelegt.
-
Ich hatte 30 Folgen von ALF auf Kassette abzugeben. Vielleicht sucht hier jemand welche?
-
Sind das abgeschlossene Folgen, so dass man Queerbeet hören kann?
Kann man durchaus machen.
-
ist immer noch meine Sache, ob ich ne DVD kaufe oder nicht, warum will man immer was aufdrängen, nur weil andere etwas anderes lieber kaufen. Ist echt nervig. Ich kaufe das, was ich möchte, nicht das was andere wollen.Aktzeptiert das doch einfach mal

Er hat doch normal gefragt. Warum geht's du denn da gleich so in die Luft? Ich würde mal meinen er wollte nur die Beweggründe verstehen warum man das "schlechtere" Medium wählt wenn es eine bessere Alternative gibt.
Also ich für meine Teil ist die Qualität nicht egal und greife daher immer zur Blu-Ray wenn es den Film oder die Serie auf diesem Medium gibt.
Wenn es das gesuchte nicht auf Blu-Ray gibt dann erwerbe ich die DVD Version. Aber es gibt schon einen deutlich, sichtbaren Unterschied in den Bildqualität zwischen Blu-Ray und DVD.
-
Bei uns wird Spongebob immer noch mit großer Freude geschaut.
-
Professor Zamorra - 5. Bis die Teufel kamen
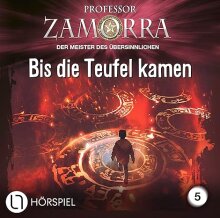
Gabriel und seine Freunde sind die Außenseiter in ihrer Klasse und haben somit auch nicht viel Spaß beim Ausflug in ein Landschulheim. Bei einem Streifzug sehen sie durch ein Fenster in einem kleinen Haus ein angeschaltetes Videospiel, das sie sofort fasziniert. Doch nachdem sie sich hineinschleichen und mit dem Spiel beginnen, werden nicht alle von ihnen das Haus auch wieder verlassen. Erst lange Zeit später stößt auch Professor Zamorra über den Fall - ein einem kleinen Theater...
Professor Zamorra ist als eigenständige Serie bei Lübbe Audio durch die bekannte Umsetzung von John Sinclair eingeführt worden, und auch in der fünften Folge wird eine kleine Anspielung auf die Schwesterreihe eingebaut. Der Start widmet sich zunächst den oben beschriebenen Ereignissen im Landschulheim, Zamorra und seine Partnerin Nicole Duval kommen erst nach einiger Zeit vor. Das gibt der Handlung den Raum, hier eine spannende und bedrohliche Grundlage zu schaffen, die in den Ereignissen einige Jahrzehnte später gekonnt weitergeführt wird. Die Zuhörenden haben dadurch natürlich einen Wissensvorsprung gegenüber den beiden Geisterjägern und können sich einige Zusammenhänge schneller erschließen. Dennoch gibt es noch viele Rätsel, die lange Zeit ungelöst bleiben und für den passenden Mystery-Flair sorgen. Wenn dann schließlich die Karten auf dem Tisch liegen, gibt es noch einen epischen Kampf, der nur äußerst knapp ausgeht, sodass das Finale noch einmal einen anderen Ausdruck erhält. Hier spielt alles zusammen und bietet viel Abwechslung, sodass mir "Bis die Teufel kamen" gut gefallen hat.
Gabriel Simone wird in dieser Episode von Sebastian Fitzner gesprochen, der seinen Szenen eine ausdrucksstarke Wirkung verleiht und den Mystery-Aspekt mit seiner Stimme verstärkt. Auch Lisa Cardinale feuert die Atmosphäre der Handlung an und bietet einen variablen Klang an, der auf jede Szene zugeschnitten ist und so lebendig und authentisch wirkt. Volker Wolf hat einige beeindruckende Auftritte, mit voller und kräftiger Stimme schafft er eine Figur mit markanter Ausstrahlung, die durch einige Effekte noch besser zur Geltung kommt. Auch Olaf Pessler, Pia-Rhona Saxe und Louis Friedemann Thiele sind zu hören.
Um den Vergleich mit John Sinclair auch hier zu bemühen: Ganz so knallig und laut geht es bei Professor Zamorra auch in dieser Episode nicht zu. Dafür wird in der akustischen Gestaltung mehr Wert auf eine ruhige, aber mysteriöse Stimmung gelegt, die in den richtigen Momenten aber effektvoll hochfährt und so die Wirkung einiger Momente gekonnt verstärkt.
Geheimnisvolle Kreise, die in der Luft schweben und zahlreiche magische Symbole zeigen, dazu noch in einem düsteren Rot leuchten und die dunkle SIlhouette eines jungen Mannes in ihnen zeigen - das Titelbild der Episode ist passend und hat eine geheimnisvolle Wirkung. Im Inneren des kleinen Booklets ist neben den üblichen Angaben und einer Folgenübersicht noch ein kleines Interview mit Autor Uwe Voehl zu leseb.
Fazit: "Bis die Teufel kamen" startet mit einer intensiven und bedrohlichen Szene einige Jahrzehnte vor der eigentlichen Handlung und setzt gelungen die Parameter der Episode. Wie sich dies weiterentwickelt ist kurzweilig und spannend geraten und eher ruhig erzählt, wobei gegen Ende natürlich auch wieder mehr Druck aufkommt. Gelungen!
VÖ: 26. April 2024
Label: Lübbe Audio
Bestellnummer: 9783785786246

